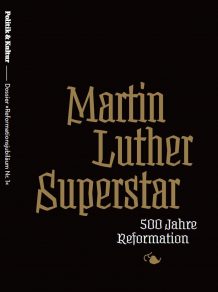Martin Luther erlebte die Frömmigkeit seiner Zeit vielfach als eine erschreckend veräußerlichte Frömmigkeit. Er bezieht sich in diesem Zusammenhang öfter auf einen Abschnitt aus der Bergpredigt: „Wenn ihr betet“, so Jesus, „sollt ihr nicht sein wie die Heuchler“. Viele Gebete, viele Rituale und sakramentale Handlungen waren nach seiner Wahrnehmung entleert, weil sie nicht aus dem Glauben heraus ihre Kraft bezogen, sondern eher eine Angst dahinter stand, man wurde ohne diese „Werke“, wie Luther es nennt, das Heil verlieren, keine Vergebung der Sünden erhalten und aus dem Stand der Gnade herausfallen.
Vor diesem Hintergrund betont er den Glauben als das alles Entscheidende. Christliches Leben lässt sich nicht aufspalten: zum einen in ein weltliches Tun, zum anderen in ein geistliches Leben. Vielmehr umfasst der Glaube den ganzen Menschen, all sein Tun und Lassen. Der Christenmensch, so Luther, ist vor Gott gerecht und das heißt, er muss nicht ständig um sein Heil bangen. Er weiß es mit Tod und Teufel aufzunehmen, bei all seinem Tun ist er sich der Gegenwart Gottes gewiss. Er begeht keine groben Untaten, aber ansonsten lebt er wie jeder andere. Nicht dadurch werde ich Christ, dass ich dies oder jenes tue, sondern weil mir Christus geboren und gegeben ist, schreibt er. Damit wertet Luther das weltliche Leben theologisch stark auf. Arbeit ist Gottesdienst. Er zitiert hierfür den Kirchenvater Hieronymus: „Alle Werke der Gläubigen sind Gebet“, und wiederholt das Sprichwort: „Wer treulich arbeitet, der betet zwiefaltig“. Das heißt, hier ist theologisch angelegt, was für den Protestantismus so typisch werden wird: Um Christ zu sein bedarf es nicht des Kirchganges. Sondern oft unausgesprochen schwingt der Verdacht mit, es handele sich hier doch nur um veräußerlichte Rituale. Es komme vielmehr darauf an, was innerlich geglaubt wird. Doch Luther würde stark verkürzt werden, wenn nur dies in den Blick käme: Denn der Gegenpol zu diesem äußerlich eher unauffälligen, ganz normalen weltlichen Leben eines Christen ist für Luther das Gebet. Hier gewinnt er seine Kraft. Ein Christ lebe zwar immer im Geist des Gebets, trotzdem solle auch das äußerliche, mündliche Gebet nicht verstummen. Er geht dabei von einer Grunderfahrung aus, die auch heute recht gut nachvollzogen werden kann. Es scheint ein recht moderner Gedanke: Das Beten fällt uns nicht von selbst zu. Viele spüren nicht automatisch das Bedürfnis, regelmäßig zu beten. Sondern wir brauchen als Menschen hierfür äußere Hilfestellungen, feste Zeiten, Rituale. Das heißt, in seiner kritischen Ablehnung aller veräußerlichten Frömmigkeit schlägt er jetzt nicht zur anderen Seite aus und meint, es müsse jetzt immer alles aus innerster Regung und aus freier Initiative geschehen. Sondern er tritt einer Selbstüberforderung entgegen, indem eben nicht ständig hinterfragt werden muss, ob das Gebet auch wirklich ganz aus einem selbst komme. Vielmehr bedarf es einer eingeübten Regelmäßigkeit des Betens und dabei können vorgegebene Texte eine große Hilfe sein.
„Das Beten fällt uns nicht von selbst zu“
So gibt es einen ausführlichen Brief, den Luther an seinen Freund schreibt, es ist zugleich sein Barbier, zu dem er offensichtlich regelmäßig geht. „Wie man beten soll. Für Meister Peter, Barbier“, so ist dieser Brief überschrieben. Und hier beschreibt Luther sehr anschaulich, wie er öfter „durch fernliegende Geschäfte oder Gedanken kalt und unlustig zum Beten“ geworden ist. Und dann hält er sich an äußeren Dingen fest. „Ich nehme mein Psalmbüchlein, laufe in die Kammer oder, wenn Tag oder Zeit dazu geeignet ist, in die Kirche unter die Leute und fange an, die zehn Gebote, das Glaubensbekenntnis und, je nachdem ich Zeit habe, einige Sprüche von Christus, von Paulus oder aus dem Psalmen bei mir selbst mündlich herzusagen, gerade so, wie es die Kinder machen. Darum ist’s gut, dass man am frühen Morgen das Gebet das erste und am Abend das letzte Werk sein lasst; man hüte sich dabei fleißig vor jenen falschen, trügerischen Gedanken, die sagen: Warte noch ein wenig; in einer Stunde will ich beten, ich muss vorher noch dies oder das erledigen. Denn mit solchen Gedanken kommt man vom Gebet weg in die Geschäfte hinein, die halten und umfangen einen dann, so dass aus dem Gebet an diesem Tage nichts mehr wird“. Zum einen die Ablehnung Luthers von veräußerlichten Ritualen, zum anderen seine Einsicht in die Notwendigkeit fester Zeiten und Texte als Hilfe für die eigene Glaubenspraxis: Das Reformationsjubiläum bietet die Chance dieser Spannung nachzugehen. Denn entleerte Rituale halten bis heute viele ab, in den institutionalisierten Kirchen auch nur irgendetwas für den eigenen Glauben zu suchen. Zum anderen können und sollen die Kirchen Raum bieten, äußere Hilfestellungen und feste Zeiten zum Gebet.
Der Text ist zuerst in Politik & Kultur 02/2014 erschienen.